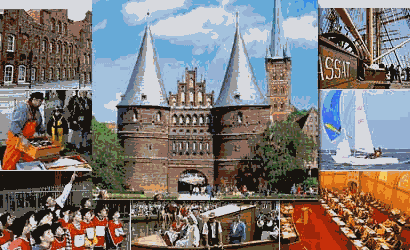
![]()
Vorbereitung und Einstimmung zum
Jahresausflug des Patenkreises am
21. – 22. Oktober 2000
Von der Schiffergesellschaft zu Lübeck
und ihrem Haus in der Breiten Straße Nr. 2
-1535 -. So leuchten goldene Jahreszahlen von der Frontseite eines der schönsten Treppengiebelhäuser der Hansestadt Lübeck herab auf die Breite Straße.
Sinnsprüche und Segelschiffe dekorieren Fassade und Beischlagwangen. Den auf der obersten Giebelstufe stehenden, weithin sichtbaren Hausschmuck - die Weltkugel, eine als Wetterfahne dienendes Segelschiff und die über allem thronende Krone aus dem Wappen der Schifferbrüder - ließen sich die Eigentümer bereits vor Jahrhunderten vergolden.
Tritt der neugierig gewordene nun über drei Stufen durch das Portal mit dem Rokoko-Oberlicht, dann steht er in der " klassischsten Kneipe " der Welt. So bezeichnete der vom Ambiente faszinierte Schriftsteller Hans Leip die historische Gaststätte " Schiffergesellschaft " .
Ein an einem der vielen Deckenbalken hängender riesiger Kronleuchter, dessen brennende Kerzen abends eine unnachahmliche Atmosphäre schaffen , beherrscht die ehemalige Versammlungshalle der Lübecker Schiffer.
Segelschiffsmodelle aus verschiedenen Jahrhunderten schweben unter der Decke. Lange Bankreihen mit hohen Rückenlehnen, sogenannte Gelage, stehen an ebenso langen aus Schiffsplanken gefertigten Eichentischen. Unwillkürlich wird man zum Verweilen bei Bier oder gutem Essen eingeladen
Ein wenig Zeit braucht der Besucher, um die Vielzahl der Erinnerungsstücke zu bewundern, die Schifferbrüder im Laufe der Jahrhunderte aus aller Welt mitbrachten. Doch nicht nur diese Exponate wecken das Interesse des Gastes.
Großflächige manieristische Wandgemälde aus den Jahren 1624 und 1625, Schnitzereien und viele andere Details erinnern an die lange und traditionsreiche Geschichte dieses denkmalgeschützten Hauses und die noch längere der am 26. Dezember 1401 als St. Nikolaus Bruderschaft gegründete Vereinigung.
Damals schlossen sich viele der in jener Zeit stark religiös lebenden Menschen in Bruderschaften zusammen, um ihre gottesfürchtigen, geselligen und wirtschaftlich sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Deutlich wird dieses unter anderem in einem Textabschnitt aus der Gründungsurkunde der St. Nikolaus Bruderschaft, der folgendermaßen lautet:
" Zu Hilfe und Trost der Lebenden und Toten und aller, die ihren ehrlichen Unterhalt in der Schifffahrt suchen.".."
Fast alle religiösen Bruderschaften lösten sich im Zuge der Reformation ( um 1530 ) auf. In diese Zeit fiel der Zusammenschluß mit der erstmalig 1495 erwähnten St. Annen - Bruderschaft. Es entstand eine ausschließlich aus Seeleuten bestehende Standesorganisation, die " Schippern Selschup ". Deren " Olderlude " erwarben 1535 gegenüber von St. Jacobi für 940 Mark lübisch Grundstück und Haus an der Ecke Engelsgrube/ Breite Straße. Bereits im Jahre 1292 erwähnte man diese Liegenschaft in einer Urkunde.
Durch Neu- und Umbauarbeiten entstand bis zum Jahre 1538 die jetzt fast noch in ihrer ursprünglichen Form existierende historische Halle. Außerdem konnten durch Integration von Nachbargebäuden 18 Wohnungen geschaffen werden.
Die Bindung zu Kirche und Religion ging nicht verloren. In dem neu entstandenen Haus bewahrte man die Kolossalstatuen des Heiligen Nikolaus und der Anna Selbdritt auf. Mit dem Bereitstellen von Speisen und Wohnraum für Alte und Bedürftige kamen die Schiffer weiterhin ihrer sozialen Verpflichtung nach.
Durch den innerhalb der Standesorganisation versammelten seemännischen und nautischen Sachverstand wuchsen im Laufe der Jahre der " Schiffergesellschaft " etliche öffentliche, hauptsächlich durch Älterleute wahrgenommene Aufgaben zu.
Erwähnenswert sind z. B. das Ausstellen von Schiffspässen für das Schiffsvolk, Schiffstaxen, Bewachung des Hafens, Beratung des Senats in maritimen Fragen, insbesondere denen der Rechtspflege, Verwaltung der Sklavenkasse und natürlich die Sorge für die Ordnung innerhalb der Brüderschaft und im eigenen Hause.
Von Schiffsreisen heimkehrende Kapitäne hatten den Älterleuten vom Reiseverlauf zu berichten. Hin und wieder rapportierten die Schiffer von Havarien, Meutereien oder gar Raubüberfällen. Diese im Beichtstuhl abgegebenen Berichte unterlagen dem Urteil oder, wenn nötig, auch dem Schiedsspruch der Älterleute.
Das hansische Seerecht von 1614 schrieb ausdrücklich fest, Streitigkeiten zwischen Schiffsvolk und Schiffern seien vor dem Kollegium der Älterleute der " Schiffergesellschaft " zu regeln.
Obwohl die " Schiffergesellschaft " nicht der Zunftverfassung unterlag, bedurften ihre Statuten der Genehmigung durch den Rat der Stadt. Lübecker Schiffer waren Zwangsmitglieder.
1866 hob ein Gewerbegesetz in Lübeck den Zunftzwang auf. Diese Regelung traf auch die " Schiffergesellschaft ". Es stellte sich die Frage der Gesellschaftsauflösung. Mehrheitlich entschieden die Schiffer für einen Fortbestand ihrer Organisation als freie Genossenschaft, die die gewerblichen Interessen ihrer Mitglieder zu verfolgen, sowie Hilfsbedürftige aus ihrem Kreise und Schifferwitwen zu unterstützen hatte.
Der neue rechtliche Status brachte ökonomische Schwierigkeiten. Schnell wuchsen Schulden zu einer Gesamthöhe von 4000 Courantmark auf. Ein Verkauf des historischen Gebäudes schien unabwendbar und die Schifferbrüder faßten einen entsprechenden Beschluß. Dem Vorstandsmitglied J. H. Wenditz gelang es jedoch mehrfach, die Umsetzung des klaren Abstimmungsergebnisses hinauszuzögern.
Letztendlich erreichte er die Umwandlung des schon in der damaligen Zeit als wertvolle Antiquität angesehenen Gebäudes in eine der Öffentlichkeit zugängliche und von Pächtern geführte Gaststätte. Durch die Einnahmen aus der Schankwirtschaft gelang es der Gesellschaft, sich wirtschaftlich zu erholen.
Gegen Ende der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts war man bereits in der Lage, das auch noch heute betriebene Witwenhaus, den Schifferhof, zu bauen.
Um einer Enteignung im Zuge der Gleichschaltung zu entgehen, nahm die " Schiffergesellschaft " in den dreißiger Jahren den Status der Gemeinnützigkeit an. Den 2. Weltkrieg überstanden die Gebäude der Gesellschaft unbeschädigt.
Umfangreiche Restaurierungsarbeiten an Häusern und Inneneinrichtungen konnten zwischen 1972 und 1976 durchgeführt werden. Sieht man von einigen Modifikationen ab, so entspricht die 1869 entworfene Satzung noch der heute gültigen. Mitglied der " Schiffergesellschaft " kann nur werden, wer das Kapitänspatent auf Großer Fahrt ( AG / A6 ) innehat. Bewerber müssen nachweisen, daß sie ein Schiff führten, für dessen Führung das oben erwähnte Patent vorgeschrieben ist, und in Lübeck oder Umgebung wohnen.
Im April 1999 hatte die Schiffergesellschaft, die übrigens kein eingetragener Verein, sondern eine Gesellschaft kraft Rechtserlass ist, 52 Kapitäne im Alter zwischen 36 und 93 Jahren als Mitglieder. Ihre Hauptaufgaben als Schifferbrüder liegen im sozialen Bereich und in der Pflege und Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude.
Die UNESCO (United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization
- Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur) mit Sitz in Paris wurde 1945 in London
als Sonderorganisation der UNO gegründet. Ihr gehören mehr als
150 Staaten an. Ihre Aufgaben umfassen eine internationale
Zusammenarbeit in den genannten Bereichen, die Förderung des
Zugangs der Menschen zu Bildung und Kultur, Durchsetzung der
Menschenrechte und Hebung des Bildungsniveaus.
Mit der internationalen "Konvention zum Schutz des
kulturellen und natürlichen Erbes der Welt" ist im
Dezember 1975 eine Partnerschaft in Kraft getreten zur Bewahrung
des kulturellen Erbes aller Völker und zur Erhaltung der
globalen Natur. Zu diesem Zweck hat die UNESCO eine Liste
angelegt, die zu schützende archäologische Stätten und
Nationalparks enthält. Neben der ehrenvollen Anerkennung werden
die jeweiligen nationalen Behörden verpflichtet, sich mit
größter Energie der Bewahrung dieser
"Weltkulturgüter" anzunehmen. Andernfalls kann die
Eintragung wieder gelöscht werden.
In seiner 11. Sitzung vom 7.-11.
Dezember 1987 hat der 21 Mitglieder zählende Ausschuß auf
Antrag Lübecks Teile der Altstadt in die Liste des
Weltkulturerbes aufgenommen. Diese großartige Auszeichnung teilt
Lübeck unter anderen mit den Schloßanlagen von Versailles, den
Galapagos-Inseln und den ägyptischen Pyramiden; in Deutschland
z.B. mit dem Dom Karls des Großen in Aachen. Auch eine alte hansische Bekannte ist
Partner: die Deutsche Brücke ("Tyske Bryggen") in
Bergen (Norwegen), bis 1753 eines von vier Kontoren der Hanse,
neben London, Brügge und Novgorod.
Quelle: Broschüre UNESCO-WELTKULTURERBE Hansestadt
Lübeck - Tausend Jahre lebendige Kulturgeschichtete, hrsg. vom
Amt für Lübeck-Werbung und Tourismus, Beckergrube 95, 23552
Lübeck, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege und dem
Amt für Vor- und Frühgeschichtete
| 819 | Erste slawische Burganlage von Alt-Lübeck am Zusammenfluß von Trave und Schwartau. |
| 1072 | Der Name "Liubice" wird in der Chronik des Geschichtsschreibers Adam von Bremen genannt. |
| 1138 | Zerstörung Alt-Lübecks durch heidnische Slawen. |
| 1143 | Graf Adolf II von Schauenburg gründet die deutsche Stadt Lübeck auf der Halbinsel zwischen Trave und Wakenitz, als bescheidene kaufmännische Siedlung. |
| 1157 | Die Stadt brennt nieder. Die Siedler ziehen aus. |
| 1159 | Graf Adolf II überläßt den Hügel Herzog Heinrich dem Löwen. Lübeck entsteht dort ein zweites Mal. |
| 1160 | Verlegung des Bischofssitzes von Oldenburg (Holstein) nach Lübeck. Kurz darauf erster Dombau, um 1170 auch St. Marien, St. Petri und 1177 St. Johannes-Kloster. 1181 Heinrich der Löwe wird geächtet, Lübeck von Kaiser Friedrich Barbarossa eingenommen und mit zahlreichen Vorrechten ausgestattet. |
| 1226 | Die norddeutschen Fürsten und Städte konnten die dänische Vorherrschaft abschütteln, Barbarossa erteilt Lübeck das Reichsfreiheitsprivileg. Lübeck wird freie Reichstadt, soll auf ewig dem Reichsoberhaupt unterstehen. Die Bestimmung bleibt 711 Jahre, bis 1937, in Kraft. |
| 1227 | Norddeutsche Fürsten und Städte, darunter Lübeck, besiegen in der Schlacht bei Bornhöved den Fürsten Waldemar endgültig. Zum Dank wird in Lübeck das Dominikanerkloster an der Stelle der ehemaligen königlichen Burg gegründet (Burgkloster). |
| 1239 | Erste Erwähnung der Stadtmauer. |
| 1241 | Bündnis zwischen Lübeck und Hamburg zur Sicherung des Überlandverkehrs. Erste Vertragsbindung zwischen späteren Hansestädten. |
| 1251 | Große Stadtbrände verwüsten die noch meistenteils aus Holz erbaute Stadt. Übergang zum Backsteinbau. Die großen gotischen Kirchen beginnen zu entstehen. Als erste und größte die (dritte) Marienkirche. Auch Teile des um 1220 entstandenen Rathauses werden erneuert. |
| 1286 | Der Neubau des Heiligen-Geist-Hospitals am heutigen Platz wird fertiggestellt. |
| 1289/91 | Aufstauung der Wakenitz. |
| 1293 | Beschluß der norddeutschen Handelsstädte, künftig an Stelle Visbys den Lübecker Rat als höchste Rechtsinstanz für gemeinsame Handelsniederlassungen in Novgorod anzuerkennen. |
| 1329 | Die Stadt kauft dem holsteinischen Grafen den Ort Travemünde und die Herrenfähre ab. |
| 1340 | Kaiser Ludwig der Bayer verleiht Lübeck als erster deutschen Stadt das Recht, Goldgulden zu prägen. |
| 1343 | König Magnus von Schweden und Norwegen bestätigt die Vorrechte der deutschen Kaufleute in Bergen und auf den alljährlichen schonischen Märkten. Die Auslandsniederlassungen finden in diesen Jahren ihre endgültige Form. |
| 1349-1350 | Verheerendes erstes Auftreten der Pest ("schwarzer Tod") in Lübeck und in ganz Nordeuropa. |
| 1350 | Vollendung der Marienkirche. |
| 1356 | Vollendung des Franziskanerkloster-Neubaus St. Katharinen. |
| 1358 | Erster Hansetag in Lübeck. Der Ausdruck "Städte von der deutschen Hanse" wird erstmalig urkundlichbelegt. Die Hanse als Organisationsform ist allmählich, nicht durch einen Gründungsakt, entstanden. |
| 1364-1370 | Zweiter siegreicher Krieg gegen König Waldemar, abgeschlossen durch den Frieden von Stralsund. Sicherung der hansischen Privilegien und Wirtschaftsinteressen im Norden. |
| 1375 | Besuch von Kaiser Karl IV. in Lübeck. |
| 1380-1384 | Bürgerliche Unruhen. Die mächtigen Handwerksämter, voran die Knochenhauer, wollen am Rat der Hansestadt (allein den Kaufleuten vorbehalten) beteiligt sein. Der Umsturzplan ihres Führers Hinrik Paternostermaker wird vorzeitig aufgedeckt und vereitelt. |
| 1397 | Vollendung des Strecknitzkanals als Wasserverbindung zur Elbe (erster deutscher Schleusenkanal). |
| 1408 | Bürgerlicher Aufstand; "Neuer Rat" unter Beteiligung der Handwerker. Der alte Rat geht ins Exil. |
| 1415 | Wiederherstellung des inneren Friedens unter Vermittlung der anderen Hansestädte. Der alte Rat kehrt zurück. |
| 1444 | Bau des Burgtors. |
| 1474 | Durch den Utrechter Frieden Beendigung des mehrjährigen Kriegszustandes mit England, Bestätigung der alten hansischen Vorrechte. |
| 1479 | Vollendung des Holstentores. |
| 1504 | Gründung des St.-Annen-Klosters. |
| 1529-1530 | Bürgerschaft erzwingt gegen den Rat Einführung der Reformation nach der Kirchenordnung Bugenhagens. Jürgen Wullenwever an der Spitze der demokratischen Bewegung. |
| 1534-1536 | "Grafenfehde". Wullenwever versucht mittels Kriege gegen Holland, Dänemark und Schweden die Vormachtstellung Lübecks zu erzwingen und scheitert. Er wird abgesetzt (1537 in Wolfenbüttel hingerichtet), die alte Ratsversammlung wiederhergestellt. |
| 1535 | Errichtung neuer Stadtbefestigungen (Wallanlagen). |
| 1563-1570 | Nordischer siebenjähriger Krieg (Lübeck mit Dänemark gegen Schweden), letzter ehrenvoller, aber erfolgloser Seekrieg der Stadt. |
| 1595-1641 | Errichtung neuer Bastionsanlagen. |
| 1669 | treten neun Städte der Hanse zum letzten Mal in Lübeck zusammen. Lübeck, Hamburg und Bremen bleiben bis ins 20. Jahrhundert als Freie und Hansestädte die Erben. Abschluß der Unruhen durch Bürgerrezeß, Neuordnung der Ratswahl, Beteiligung der Bürgerschaft an der Verwaltung. |
| 1716 | Handelsvertrag mit Frankreich (Rotweinhandel). |
| 1803 | Nach dem Reichdeputationshauptbeschluß bleiben nur noch sechs Reichsstädte bestehen, darunter Lübeck. |
| 1806 | Am 6. November Schlacht zwischen Blücher und den Franzosen bei Lübeck. Mit den fliehenden preußischen Truppen dringen die Franzosen in Lübeck ein und halten die Stadt besetzt. Plünderung. |
| 1806-1813 | Französische Besatzung |
| 1815-1866 | Lübeck wird Mitglied des deutschen Bundes. |
| 1847 | Gegen dänischen Widerstand wird der Bahnbau Lübeck-Büchen durchgesetzt und 1851 vollendet |
| 1848 | Revolutionäre Bewegung. Verfassungsänderung, gewähltes Parlament. |
| 1865 | Die Bahnlinie Lübeck-Hamburg wird eröffnet. |
| 1866 | Eintritt in den norddeutschen Bund. Einführung der Gewerbefreiheit. |
| 1871 | Die Freie und Hansestadt Lübeck wird Gliedstaat des Reiches. |
| 1900 | Fertigstellung des Elbe-Lübeck-Kanals. |
| 1906 | Gründung des Hochofenwerkes. |
| 1912 | Fertigstellung der Traveregulierung (Seeschiffweg bis zur Stadt). |
| 1920 | Einführung einer parlamentarischen Landesverfassung. |
| 1933 | Absetzung des Senates, Abschaffung der Bürgerschaft, Regierung durch Bevollmächtigten der NSDAP. Gemeinsamer "Reichsstatthalter" für Lübeck und Mecklenburg mit Sitz in Schwerin. |
| 1937 | Abschaffung der Reichsfreiheit Lübecks, Eingleiderung in die preußische Provinz Schleswig-Holstein. |
| 1942 | Am 28. März werden große Teile der Altstadt durch Bomben vernichtet. |
| 1945 | Lübeck wird kampflos von britischen Truppen besetzt. |
| 1945-1948 | Durch Kriegsfolgen und Grenzziehung völlige Lähmung von Wirtschaft und Verkehr. Einströmen von ca. 90.000 Vertriebenen. |
| 1949 | Beginn des Wiederaufbaus der Altstadt und der zerstörten Kirchen. |
| 1950 | Einführung der neuen Stadtverfassung nach der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeordnung. |
| 1961 | Alle Türme der zerstörten Kirchen sind wieder aufgebaut. |
| 1971-1973 | Fußgängerzone in der Breiten Straße eingerichtet. |
| 1975 | Lübeck wird im Denkmalschutzjahr zusammen mit Regensburg und Bamberg zum Pilotprojekt einer behutsamen Stadtsanierung erwählt. Danach intensive Sanierungsarbeiten, Lübeck wird zum Sanierungsschwerpunkt der Bundesrepublik. |
| 1987 | Der Wiederaufbau der letzten Lübecker Altstadtkirche - St. Petri - wird abgeschlossen. Die UNESCO erklärt Lübeck zum Weltkulturerbe - das erste Kulturdenkmal dieser Art in der Bundesrepublik. |
| 1993 | 850 Jahre Hansestadt Lübeck |
| 1996 | (vorrausichtlich) Alstadt wird ganz für den KFZ-Verkehr gesperrt. |
Quelle: Broschüre Hansestadt Lübeck - UNESCO Weltkulturerbe, Tausend Jahre lebendige Kulturgeschichtete des Amtes für Lübeck-Werbung und Tourismus, Beckergrube 95, 23552 Lübeck, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege und dem Amt für Vor- und Frühgeschichtete.
Lübecks Geschichte und Lübecks Wachstum sind untrennbar verbunden mit der führenden Rolle der Stadt in der Hanse. Die Hanse ("hansa" ist die althochdeutsche Bezeichnung für eine Schar oder Gruppe) war zunächst ein Zusammenschluß norddeutscher Kaufleute, der nach der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einer Städtegemeinschaft umgewandelt wurde. Die Hanse bot ihren Mitgliedern Schutz im Ausland, vertrat ihre Handelsbelange gegenüber fremden Machthabern, verschiedenesaffte ihren Mitgliedern Handelsprivilegien (Zollbefreiung) und entschied Streitigkeiten ihrer Mitglieder durch eine eigene Gerichtsbarkeit, die von den Ältesten, den sogenannten Oldermännern, ausgeübt wurde.
Der Hanse gehörten in ihrer Glanzzeit rund 200 Hafen- und Binnenstädte an. Ihr Gebiet umfaßte den Bereich zwischen Zuidersee und Finnischem Meerbusen, Ostsee und Thüringen. Kein anderer Städtebund des Mittelalters erreichte auch nur annähernd den Einfluß oder die Ausdehnung der Hanse.
Obwohl die Hansestädte sich zur Förderung des Handels zusammengeschlossen hatten, entwickelten sie sich im Laufe der Geschichte in Nordeuropa auch zu einer politischen Macht, die sogar erfolgreich Kriege führte. Den Höhepunkt bildete der Krieg, den die Hansestädte 1364 bis 1370 gegen Waldemar IV. von Dänemark führten. Militärische Maßnahmen der Hanse dienten der Durchsetzung von wirtschaftlichen Zielen, wenn Verhandlungen oder Handelsboykott nicht mehr fruchteten.
Urzelle der Hanse im Ostseeraum - Kölner Kontakte mit Westeuropa liefen parallel - war die Genossenschaft der Gotland ansteuernden deutschen Kaufleute. Diesen "Gotlandfahrern" gehörten Kaufleute nicht nur aus Lübeck, sondern auch aus westfälischen und sächsischen Städten an.
Weitere Etappen sind die Entstehung der deutschen Kaufmannsniederlassung in Novgorod Ende des 12. Jahrhunderts und der erste Vertrag zwischen Lübeck und Hamburg um 1230. Nach und nach schlossen sich auch die Kaufleute aus den neugegründeten Städten an der slawischen Ostseeküste dem Verbund an.
Lübeck, das Tor Westeuropas zum Ostseehandel, nach Skandinavien und zum Baltikum, blühte rasch auf und wurde zum Haupt der Hanse. Es behielt seine führende Stellung bis zum Ende des Bundes - unter anderem aufgrund seiner günstigen Lage zwischen Nord- und Ostsee und der damit verbundenen wirtschaftlichen Bedeutung. Große Niederlassungen der Hanse (Kontore) entstanden in London, Brügge, Bergen und Novgorod. Diese Kontore verdeutlichen den geographischen Rahmen, in dem die Kaufleute der Hanse seit Mitte des 13. Jahrhunderts fast ein Handelsmonopol besaßen. Im 14. Jahrhundert knüpfte der hanseatische Handel zu Lande Kontakte nach Süddeutschland und Italien, der Seehandel dehnte sich aus nach Frankreich, Spanien und Portugal. Widerstand gegen das Handelsmonopol der Hanse leisteten Niederländer, Engländer und Süddeutsche - seit Mitte des 14. Jahrhunderts mit Erfolg.
Der Städtebund, übrigens ohne Satzung und Kasse, nur durch die unregelmäßig stattfindenden Hansetage (meistens in Lübeck) gebunden - erreichte seine größte Macht zur Zeit des Friedens von Stralsund (1370) nach dem Sieg über Dänemark. In den folgenden Jahrhunderten ging der Einfluß der Handelsmacht Hanse jedoch langsam zurück (1478 Schließung des Kontors in Novgorod, Schließung des Stalhofs in London 1598), da diese Bündnis- und Handelsform auf die Dauer nicht mit der Wirtschaftspolitik der frühneuzeitllchen Staaten konkurrieren konnte. Einerseits nahmen die einzelnen Länder (ausländische Herrscher und deutsche Landesfürsten) den Handel selbst in die Hand und behinderten den hanseatischen Handel, andererseits erwiesen sich die kombinierten Waren- und Geldgeschäfte der großen Handelshäuser (Fugger, Welser) als bei weitem einträglicher und flexibler als der hauptsächlich auf Waren beschränkte Hansehandel.
1630 schlossen Lübeck, Hamburg und Bremen ein engeres Bündnis, das insbesondere die finanziellen Interessen der sich auflösenden Hanse wahrnehmen sollte. Ein letzter allgemeiner Hansetag in Lübeck (1669), zu dem noch 9 Städte erschienen, konnte die Hanse nicht wiederbeleben. Die Verbundenheit zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen blieb jedoch bis 1920 beziehungsweise 1937 bestehen. Die Hansestadt Lübeck verlor ihre Selbständigkeit nach über 700 Jahren durch das von dem nationalsozialistischen Regime im Jahre 1937 erlassene sogenannte Großhamburggesetz, das die Stadt in die preußische Provinz Schleswig - Holstein eingliederte. Bestrebungen, Lübeck nach dem Kriege die Selbständigkeit zurückzugeben - ähnlich wie Hamburg und Bremen, die Bundesländer wurden - blieben erfolglos.
Der Gedanke der Hansetage wurde 1980 von der niederländischen Stadt Zwolle wiederbelebt. Der dritte Hansetag der Neuzeit im Jahre 1983 fand wieder in Lübeck, der einstmaligen Königin der Hanse statt.
Die UBC ist ein Netzwerk von Städten rund um die
Ostsee, die sich einer grenzüberschreitenden Arbeit ohne
Zwischeninstanzen wie Länder oder Bundesverwaltungen
verschrieben haben. Die Hansestadt Lübeck ist seit der Gründung
im Jahre 1991 Mitglied dieses Städtebundes, dem auch viele Hansestädte angehören. Der UBC zählt derzeit 84
Mitgliedsstädte in zehn Nationen.
Basis der Zusammenarbeit ist die Verpflichtung zu einer
gemeinsamen Entwicklung von Demokratie, Wirtschaft, Sozialwesen,
Kultur und Umweltschutz in den jeweiligen Mitgliedsstädten.
Die aktive Zusammenarbeit der Städte findet in zehn Kommissionen
statt, die jeweils von einer anderen Stadt geleitet werden. Ihre
Themen sind:
Die Kommissionen starten und
koordinieren Projekte, spezielle Veranstaltungen und eine Reihe
von Aktivitäten. Jede Stadt bringt sich selbst mit ihren Ideen
und Aktivitäten ein.
Die UBC ist als Beobachter zugelassen beim Rat der Ostseeländer
(CBSS), beim Parlamentarischen Rat der Zusammenarbeit im
Ostseeraum, bei der Helsinki Kommission (HELCOM) und beim
Europäischen Rat für lokale und regionale Behörden (Council of
Europe´s Congress of Local and Regional Authorities
(CLRAE).Oberstes Organ der UBC ist die Generalkonferenz.
Präsident der UBC ist Kalmars Bürgermeister Anders Engström.
Vizepräsidenten sind Lübecks Bürgermeister Michael Bouteiller
und Bartlomiej Sochanski, Stettin. Das Sekretariat der UBC
befindet sich in Danzig.
Die Hansestadt Lübeck unterhält
seit 1969 eine Städtepartnerschaft mit Kotka, dem
wichtigsten Exporthafen Finnlands. Aus Wirtschaftsgesprächen
entwickelte sich eine Freundschaft. Die Verbindung wird unter
anderem durch kulturelle und sportliche Begegnungen gepflegt.
Bereits im Mittelalter sollen zwischen den beiden Städten
Handelsbeziehungen bestanden haben.
Ende 1987 schloß Lübeck mit der
Werft- und Hafenstadt Wismar in der DDR - jetzt im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern - einen Vertrag über eine
deutsch-deutsche Städtepartnerschaft. Wismar, ehemals Mitglied
des Hansebundes, und die Hansestadt Lübeck liegen nur etwa 60
Kilometer voneinander entfernt an der Ostsee und weisen aufgrund
ihrer geschichtlichen Entwicklung auch im Stadtbild zahlreiche
Gemeinsamkeiten auf. Vereinbart wurden der Meinungs- und der
Erfahrungsaustausch sowie nach der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten die Unterstützung bei dem Aufbau der Wismarer
Stadtverwaltung.
Ein bereits seit 1980 bestehender
Freundschaftsvertrag mit La Rochelle
wurde 1988 in eine Städtepartnerschaft umgewandelt. Verbindungen
zwischen der französischen und der deutschen Hafenstadt
bestanden bereits seit 1977. Sie begannen mit einem
Schüleraustausch. Heute gibt es rege Kontakte vor allem auf dem
Gebiet des Sport- und Jugendaustausches.
Eine Städtepartnerschaft mit der litauischen Hafenstadt Klaipeda (Memel) schloß die Hansestadt Lübeck im Frühjahr
1990 ab. Die beiden Städte wollen sich auf allen Gebieten der
Kommunalverwaltung und -politik austauschen. Auf längere Sicht
streben sie eine Verbindung durch eine Fährschiffslinie an.
Die jüngste Partnerschaft mit der schwedischen Hansestadt Visby
besteht seit 1999. Unterzeichnet wurde der Partnerschaftsvertrag
am 17. September im Lübecker Rathaus. Die Städtepartnerschaft
erstreckt sich ausdrücklich auf die gesamte Insel Gotland, deren
Hauptstadt Visby ist. Die beiden Partner frischen mit dem
Vertragsschluß Verbindungen auf, die bereits seit dem 12.
Jahrhundert bestehen.
Durch Freundschaftsverträge ist die Hansestadt Lübeck seit 1979
mit Venedig, seit
1980 mit der amerikanischen Stadt Spokane (Washington) und seit 1992 mit der
japanischen Hafenstadt Kawasaki verbunden. Die Beziehungen zu
Venedig wurden 1972 aufgenommen. Die Kontakte entstanden, als die
Lagunenstadt in Zusammenhang mit einer Veranstaltung der
Deutschen Fernsehlotterie eine Galeonenregatta in Lübeck
organisierte.
Die Freundschaft mit Spokane (Washington) entwickelte sich nach
Besuchen des damaligen Bürgermeister David Rogers 1977 in der
Hansestadt und des Lübecker Bürgermeisters Dr. Robert Knüppel
1978 in der amerikanischen Stadt, in der etwa 30 Prozent
deutschstämmige Bürger leben. Der Austausch von Schülern und
gegenseitige Besuche von Wirtschaftsdelegationen folgten. Die
Freundschaftsurkunden wurden im Mai 1980 ausgetauscht.
Einen Freundschaftsvertrag mit Bergen/Norwegen schloß Lübeck im
Jahre 1996. Mit dieser alten Hansestadt will man in den nächsten
Jahren zu einer engen Partnerschaft kommen, genau wie mit Visby
auf der Insel Gotland in Schweden, mit dem Lübeck eine lange
gemeinsame Geschichte verbindet.
Freundschaftliche Beziehungen unterhält Lübeck mit mehr als 100
europäischen Städten, die regelmäßig an den Hansetagen der Neuzeit teilnehmen.
Im September 1991 beteiligte sich Lübeck in Danzig an der
Gründung der Union of the Baltic Cities, die eine umfassende Zusammenarbeit der Städte
rund um die Ostsee zum Ziel hat. In der Region HOLM arbeitet
Lübeck seit 1992 zusammen mit den Kreisen Gadebusch,
Grevesmühlen, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Schwerin,
Segeberg, Stormarn und Wismar sowie den Städten Schwerin und
Wismar und den Industrie- und Handelskammern zu Lübeck, Rostock
und Schwerin.
Johann Balhorn d.J., druckte 1575 - 1604 in Lübeck
Kaum jemand weiß, daß das Wort "verballhornen" von dem Namen des Lübecker Buchdruckers Balhorn abgeleitet ist. Der Name steht fälschlicherweise als Synonym für grobe und sinnentstellende Textverstümmelungen. Balhorn hatte 1586 eine überarbeitete Fassung des nach 350 Jahren überholungsbedürftigen Lübecker Stadtrechts gedruckt, die viele eigenmächtige Änderungen enthielt. Das war um so schlimmer, als sich viele andere Städte nach dem Lübecker Stadtrecht richteten. So war die Neuauflage die Ursache für zahlreiche Rechtsstreitigkeiten. Allerdings tat man Balhorn wohl Unrecht. Die Änderungen stammten nicht von ihm. Zwei Juristen des Rates hatten das Lübecker Recht "aufs Neue übersehen und korrigiert".
Willy Brandt, 1913 - 1992 (früher: Herbert Ernst Karl Frahm)
Friedensnobelpreisträger (1971), wurde in Lübeck geboren und besuchte hier die Schule bis zum Abitur. Seine ersten Begegnungen mit der Politik erlebte er im Lübeck der zwanziger Jahre. 1933 Flucht über Dänemark nach Norwegen, 1940 Flucht nach Schweden, kehrte 1945 als Korrespondent skandinavischer Zeitungen nach Deutschland zurück, 1947 Wiedereinbürgerung unter seinem Schriftstellernamen Brandt. 1957 - 1966 Regierender Bürgermeister von Berlin, danach Außenminister und Vizekanzler der Großen Koalition 1966-69, seit 1976 Präsident der Sozialistischen Internationale. Während seiner Zeit als Bundeskanzler (1969-74) verfolgte er vor allem außenpolitische Aktivitäten (Atomwaffensperrvertrag, Dt.-Sowjet. Vertrag und Dt.-Poln. Vertrag 1970), aber auch in der Deutschland- und Berlinpolitik (Gipfeltreffen mit W. Stoph 1970, Viermächteabkommen über Berlin 1971). Von 1964 bis 1987 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, anschließend Ehrenvorsitzender. 1972 verlieh die Hansestadt Lübeck Willy Brandt die Ehrenbürgerschaft.
Carl Jacob Burckhardt, 1891 - 1974
Schweizer Diplomat und Historikprofessor. Burckhardt rettete während des Zweiten Weltkrieges als Präsident des Internationalen Roten Kreuzes die Hansestadt Lübeck vor der drohenden Gefahr der völligen Zerstörung. Im Juni 1944 lag der Alliierte-Verbindungshafen Marseille im Operationsgebiet. In langen Verhandlungen erreichte Burckhardt das Zugeständnis, ersatzweise Lübeck zum Umschlaghafen für Rotkreuzschiffe und zum Lagerplatz der Hilfssendungen für die alliierten Kriegsgefangenen in Deutschland zu bestimmen. Auf diese Weise rettete er die alte Hansestadt vor der vollständigen Zerstörung. Einen ersten verheerenden Bombenangriff hatte Lübeck am Palmsonntag 1942 (28.März) erlebt. Als Vergeltung für die völlige Zerstörung der britischen Stadt Coventry durch die Deutschen, faßten die Alliierten den sogenannten Baedeker-Plan, der die systematische Zerstörung deutscher Städte vorsah. Als Richtschnur für die Ausführung des Planes sollte der bekannte Reiseführer dienen. - Als Dank für die Rettung der historischen Altstadt wurde Burckhardt 1950 die Ehrenbürgerschaft verliehen (Geschichte der Hansestadt Lübeck).
Dietrich Buxtehude, 1637 - 1707
Bedeutender Komponist und Organist. Von 1668 bis 1707 Werkmeister und Organist an St. Marien in Lübeck, komponierte u.a. mehr als 100 Kantaten, Klaviersuiten und -variationen sowie Orgelwerke. Für kurze Zeit war Buxtehude Lehrer Johann Sebastian Bachs in Lübeck.
Rabbiner Felix F. Carlebach, geb. 15.4.1911
Die Hansestadt Lübeck verlieh Rabbiner Carlebach die Ehrenbürgerschaft am 17. September 1987 als "ein weithin sichtbares Zeichen ihres aufrichtigen Bemühens um Aussöhnung mit ihren jüdischen Mitbürgern". Carlebach ist der 19. Ehrenbürger Lübecks. Felix F. Carlebach wurde in Lübeck als Sohn eines Bankiers geboren und verlebte seine Schulzeit in seiner Heimatstadt. Er studierte in Köln Theologie und Musik, leitete von 1933 bis 1939 die Carlebach'sche höhere Schule in Leipzig und konnte vor der Naziverfolgung nach Großbritannien flüchten. Seit 1947 ist er Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Manchester. Seine Eltern und andere Mitglieder der Familie Carlebach wurden Opfer der NS-Gewaltherrschaft. 1985 besuchte der Rabbiner erstmals wieder seine Heimatstadt. Unter dem Eindruck seiner versöhnenden Worte beschloß die Bürgerschaft der Hansestadt, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen.
Dr. Heinrich Dräger, 1899 - 1986
Als Mäzen förderte er fast 30 Jahre lang die Ausgrabungen der Lübecker Altstadt und andere archäologische Forschungen. Durch zahlreiche Spenden ermöglichte er Wiederaufbau- und Restaurierungsmaßnahmen in Lübeck sowie die Anlage eines Freizeitparks und eines Wanderweges. Die von ihm ins Leben gerufene Dr. Bernhard-Dräger-Stiftung fördert die Volks- und Jugendbildung und trug zur Erhaltung von Natur- und Kulturdenkmälern bei. Die ebenfalls von ihm gegründete Elfriede-Dräger-Gedächtnisstiftung dient der Bewahrung von Kulturgütern. Dank einer Stiftung von Dr. Dräger im Jahre 1975 konnte das Museum Drägerhaus von der Hansestadt Lübeck eingerichtet werden. Die Lübecker Bürgerschaft ernannte ihn am 30. September 1982 auf Vorschlag des Senats zum Ehrenbürger.
Franz Emanuel August Geibel, 1815 - 1884
Lyrischer Dichter, Professor für Ästhetik an der Universität München. In Lübeck geboren und gestorben, in München Mittelpunkt eines Dichterkreises. Heute sind nur noch wenige seiner Gedichte bekannt, so der Text des Volksliedes "Der Mai ist gekommen". Ihm wurde 1868 die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen (Puppenbrücke).
Rodolfo Groth, 1881 - 1985
Er verließ als junger Mann seine Heimatstadt, erwarb in Übersee als Kaufmann ein Vermögen und kehrte dann wieder nach Lübeck zurück. Seit Anfang der zwanziger Jahre stellte Rodolfo Groth immer wieder große Geldsummen für gemeinnützige Zwecke in der Hansestadt zur Verfügung. So ließ er einen Kinderpark einrichten, ermöglichte 10.000 Kindern eine unbeschwerte Ferienerholung, schenkte der Stadt einen Park, förderte eine Sonderschule und leistete Spenden für die Restaurierung des Burgklosters, des Lübecker Doms und des historischen Zeughauses. Kurz vor seinem 102. Geburtstag nahm Rodolfo Groth am 2. Dezember 1982 persönlich den Ehrenbürgerbrief aus den Händen des Bürgermeisters im Audienzsaal des Rathauses entgegen. Er starb im Alter von 104 Jahren am 7. Februar 1985.
Julius Leber, 1891 - 1945
Julius Leber, der seit 1913 Mitglied der SPD war, beteiligte sich in der Weimarer Republik 1920 an der Niederwerfung des Kapp-Putsch. In den Jahren von 1921 bis 1933 war er Chefredakteur des Lübecker Volksboten. In der SPD, deren Fraktion im Reichstag er seit 1924 angehörte, trat er als Fachmann für Wehrkunde hervor. Von den Nationalsozialisten wurde Leber von 1933 bis 1937 im Konzentrationslager festgehalten, danach war ihm nur die Betätigung als Kohlenhändler gestattet. Leber, der sich an den Vorbereitungen zum Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 beteiligt hatte, wurde am 5. Juli 1944 erneut inhaftiert und schließlich vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt.
Heinrich Mann, 1871 - 1950
Der ältere Bruder von Thomas Mann, ebenfalls Schriftsteller. 1933 wurden seine Werke von den Nationalsozialisten verboten, so lebte Heinrich Mann bis 1940 im französischen Exil und floh dann in die USA. Kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland starb er. Heinrich Mann schrieb im Engagement gegen Nationalsozialismus, Militarismus und Untertanenmentalität. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Professor Unrat" (1930 unter dem Titel "Der blaue Engel" verfilmt) und "Der Untertan", die sich kritisch mit dem selbstgefälligen Bürgertum auseinandersetzen, sowie sein Doppelroman über Heinrich IV. von Frankreich. Heinrich Mann starb in der Emigration in Kalifornien.
Thomas Mann, 1875 - 1955
Wohl der international bekannteste Lübecker, Sohn einer angesehenen Kaufmannsfamilie. Seine Kinder- und Jugendzeit verbrachte er in Lübeck. 1929 erhielt er den Literaturnobelpreis für seinen Roman "Buddenbrooks. Verfall einer Familie" (1901). Er emigrierte während der Nazizeit in die Schweiz und die USA. Das Wohn- und Geschäftshaus der Großeltern, Mengstraße 4, ist heute als "Buddenbrookhaus" bekannt und beherbergt seit 1993 das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum. Das Haus wurde im 2. Weltkrieg fast völlig zerstört. Nur die Fassade und der Gewölbekeller sind im Original erhalten. 1955 verlieh die Hansestadt Lübeck Thomas Mann die Ehrenbürgerschaft.
Bernt Notke, 1440 - 1509
Maler und Bildschnitzer, Hauptmeister der Spätgotik im Ostseeraum. Lebte und arbeitete viele Jahre in Lübeck, wo er auch starb. Eines seiner Hauptwerke: Das Triumphkreuz im Lübecker Dom.
Johann Friedrich Overbeck, 1789 - 1869
In Lübeck geborener Maler, in Rom gestorben. Mitbegründer und Hauptmeister der Nazarener, einer Gruppe junger deutscher Maler in Rom, die im christlichen Geist des Mittelalters malte. Wichtigste Werke: Die Joseph - Fresken für die Casa Bartholdy in Rom, das Selbstbildnis mit Familie im Lübecker Behnhaus und die Grablegung in der Marienkirche der Hansestadt.
Emil Possehl, 1850 - 1919
Der gebürtige Lübecker übernahm
1875 die Geschäftsführung der aufstrebenden väterlichen Firma
L. Possehl & Co., eine Eisen-, Blech- und
Steinkohlenhandlung, und entwickelte daraus in einem geradezu
kometenhaften Wachstum ein nordeuropäisches Wirtschaftsimperium.
Possehl - 1901 zum Lübecker Wirtschaftssenator gewählt - hatte
schließlich den gesamten schwedischen Erzhandel und die
Produktion des hochwertigen schwedischen Stahls in seiner Hand,
betrieb Hochofenwerke an der deutschen Ostseeküste,
Kupferhütten in Bochum und Magdeburg, Fabriken in Rußland,
Erzgruben in Lappland und vieles andere mehr. Bei seinem Tode
wurde sein Vermögen auf über 100 Millionen Goldmark geschätzt.
Sein Erbe wurde in der Possehl Stiftung angelegt, die die Aufgabe
der Förderung "alles Guten und Schönen in Lübeck"
erhielt.
Als Folge der beiden Weltkriege und der Inflation verlor die
Firma einen Großteil ihres Besitzes. Anfang der 50er Jahre
blühten die Possehl Unternehmen jedoch wieder auf. Die Stiftung
gewann mehr und mehr an Bedeutung und gab viel Geld für soziale
Zwecke und die Jugendförderung, unterstützte den Bau von
Altenheimen und Kindertagesstätten, schuf zwei Landschaftsparks,
förderte Kunst und Wissenschaft und die Sanierung und
Restaurierung historischer Bausubstanz in der Hansestadt Lübeck.
Von 1959 bis 1970 wurden über 44 Millionen Mark ausgeschüttet.